Institut für Angewandte Geowissenschaften
Institut für Angewandte Geowissenschaften
 © Oana Popa-Costea
© Oana Popa-Costea
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Wilkommen im Institut für Angewandte Geowissenschaften!
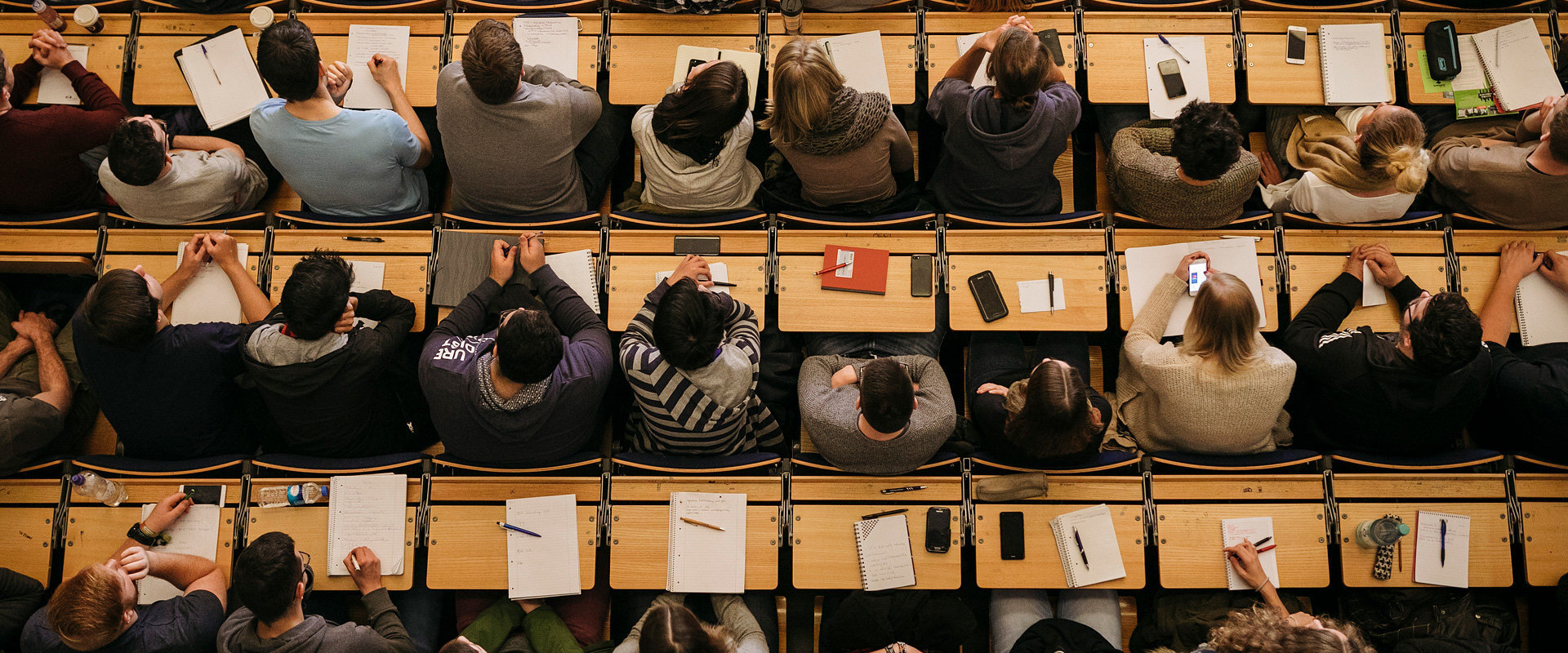
Studium & Lehre
Alle Informationen rund um den Bachelor- und Masterstudiengang Geotechnologie finden Sie hier!

Geländeausbildung
Im Studiengang Geotechnologie spielt die Geländeausbildung eine tragende Rolle.

Fachgebiete und weitere Einrichtungen
Über Uns
Studium & Lehre
Geländeausbildung
Fachgebiete & weitere Einrichtungen
